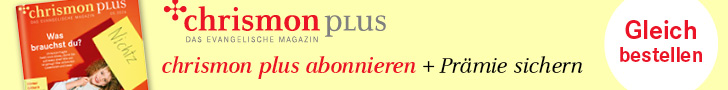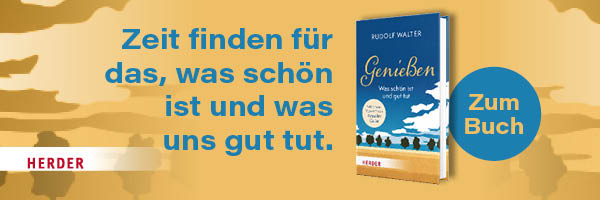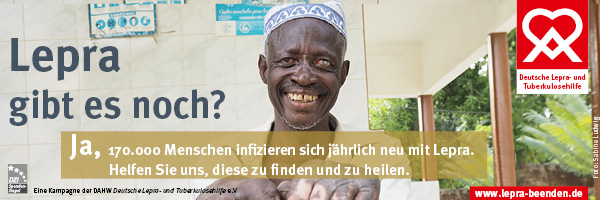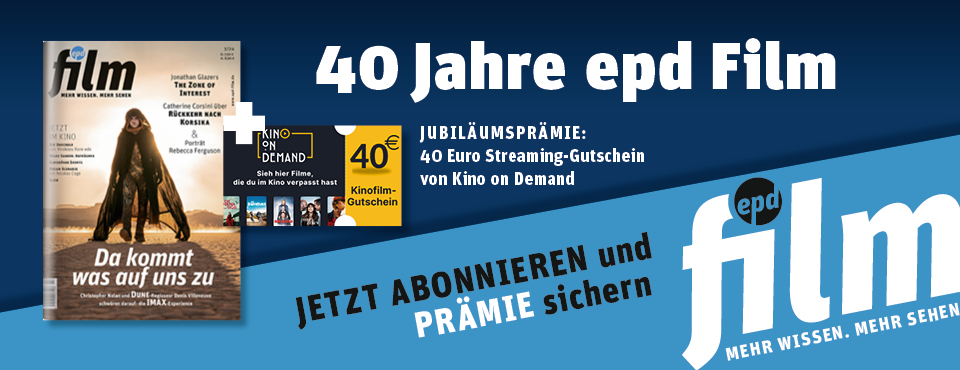Die Koffer, sagt Samuel, 24, seien zwar nicht gepackt, aber in greifbarer Nähe. Auch wenn Israel geografisch weit weg ist: Der Überfall am 7. Oktober 2023, in dessen Verlauf Hamas-Terroristen weit über tausend Israelis getötet haben, hat auch das Leben der Jüdinnen und Juden in Deutschland erheblich beeinflusst. "Jetzt ist alles anders", heißt es unter anderem in dieser Reportage von Jan Tenhaven. Der Film ist bedrückend, aber seine herausragende Qualität verdankt der "37 Grad"-Beitrag einer konzeptionellen Entscheidung: Während sich die Autorinnen und Autoren auf diesem Sendeplatz gern allwissend geben, weil ihre Kommentare stets nahelegen, sie könnten in die Köpfe und Herzen der Menschen vor der Kamera schauen, hat Tenhaven auf Erklärungen aller Art komplett verzichtet.
Das mag zunächst nicht weiter ungewöhnlich klingen und wäre bei einem Dokumentarfilm in der Tat nichts Besonderes, ist jedoch in diesem Fall weit mehr als nur eine Erwähnung wert, und das nicht allein wegen des vermeintlichen Verstoßes gegen die Gewohnheit: Die jungen Männer und Frauen, allesamt klug und reflektiert und nicht nur deshalb ausgezeichnet ausgewählt, sind sehr wohl in der Lage, für sich selbst zu sprechen, doch Tenhaven durchsetzt ihre Aussagen immer wieder auch mit Originalvideos der Hamas. Diese Aufnahmen dienten ursprünglich Propagandazwecken und wirken zum Teil wie Szenen aus einem sogenannten Egoshooter-Spiel, wenn am unteren Rand der Lauf eines Gewehrs ins Bild ragt.
Mutig ist die Verwendung dieser Ausschnitte jedoch noch in einer weiteren Hinsicht: Es wird garantiert Menschen geben, die "Schock Schalom" als einseitig empfinden, weil Tenhaven die Sache der Palästinenser nur auf diese Ebene reduziert; zu Wort kommen ausschließlich Jüdinnen und Juden. Deren Aussagen sind jedoch differenziert und ausgewogen; von Rachsucht ist jedenfalls nichts zu spüren. Allerdings muss sich der Autor zumindest den Hinweis gefallen lassen, die israelischen Vergeltungsaktionen komplett ausgespart zu haben. Dieser Aspekt entspricht daher geradezu perfekt der Redensart vom "Elefanten im Raum": Alle wissen davon, niemand spricht darüber.
Tilmann P. Gangloff, Diplom-Journalist und regelmäßiges Mitglied der Jury für den Grimme-Preis, schreibt freiberuflich unter anderem für das Portal evangelisch.de täglich TV-Tipps und setzt sich auch für "epd medien" mit dem Fernsehen auseinander. Auszeichnung: 2023 Bert-Donnepp-Preis - Deutscher Preis für Medienpublizistik (des Vereins der Freunde des Adolf-Grimme-Preises).
Davon abgesehen gibt die Reportage auch dank der Vielzahl an Gesprächen sehr nachvollziehbare Einblicke ins jüdische Seelenleben. Die jungen Leute haben unterschiedlichste Hintergründe: Manche gehen noch zur Schule, andere studieren; die einen sind mehr, die anderen weniger religiös. Durchaus typisch ist ein Musiker, der erzählt, er feiere bloß Chanukka, aber anschließend beim Autor nachfragt: Das sei doch das Fest mit den vielen Kerzen? Besonders interessant ist das Interview mit Abiturientin Nogah. Sie geht auf eine "Multikulti-Schule", wie sie sagt. Ihre beste Freundin ist ein Mädchen mit palästinensischem Hintergrund, und natürlich hat sie befürchtet, der Überfall werde zum Bruch führen. Die beiden haben sich ausgesprochen, die Beziehung blieb intakt, aber vor die Kamera wollte die Freundin nicht: aus Furcht, dass sie wegen der Freundschaft mit einer Jüdin angefeindet werde.
Anton Tsirin ist dagegen von der arabischen Community enttäuscht. Der Schauspieler hat den Verein Kibbuz e.V. – Zentrum für Kunst, Kultur und Bildung gegründet und betreibt unter anderem den YouTube-Kanal Youde; für die Videos hat er oft mit Personen mit muslimischem Hintergrund gearbeitet. Angesichts von deren Schweigen nach dem Hamas-Terror hat er jedoch kein Interesse mehr an einem Dialog: In den letzten Monaten sei sein Herz zu Stein geworden. Andere sind weniger unversöhnlich, auch wenn sie selbstredend alle betroffen sind. Samuel, angehender Rabbiner, spricht von einem "Wendepunkt für die ganze Menschheit". Paula (15) beschreibt ihre Angst vor einem Anschlag.
Sie besucht ein jüdisches Gymnasium, das rund um die Uhr bewacht wird; Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler trainieren regelmäßig, wie man sich bei Terroralarm verhalten soll. Umso erstaunlicher und respektabler ist die positive Haltung, die fast alle vermitteln. Wirtschaftsstudentin Aviva engagiert sich politisch, Tenhaven zeigt sie bei einer Kundgebung, wo sie im Rahmen einer Ansprache verkündet, sie fühle "Wut, Enttäuschung, Hilflosigkeit; aber auch Hoffnung". Wenn eines Tages jemand einen Davidstern an seine Tür male, sagt der gebürtige Moskauer Tsiris, werde er umgehend das Land verlassen. Alice (24) gibt sich dagegen kämpferisch. Die Psychologiestudentin arbeitet abends als Türsteherin einer Bar und versichert, für ihre Generation käme das nicht in frage: "Wir sind Teil dieser Gesellschaft."